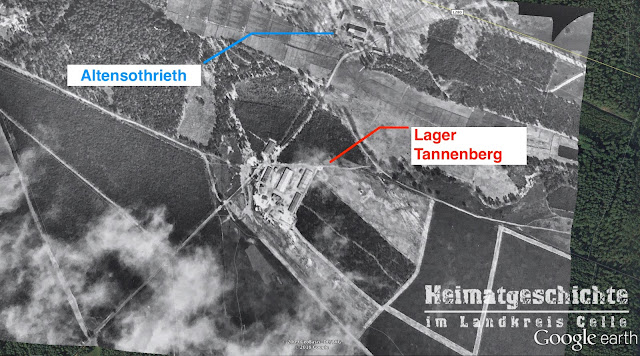Kaum eine Gegend im Landkreis Celle ist so von Mythen umrankt wie das Waldgebiet "die Sprache" zwischen Lachtehausen und Beedenbostel. Schon ihr Name ist besonders - woher er kommt - das ist bislang ungeklärt. In diesem Beitrag werden mögliche Erklärungen vorgestellt.
Vor allem Jüngeren ist sie bekannt - die Sage der "weißen Frau aus der Sprache". Ob diese tatsächlich stimmt? Moderatoren des Radiosenders ffn nahmen die Geschichte kürzlich ein wenig auf die Schippe. Eine abschließende Erklärung der Sage wird es vermutlich nicht geben. Doch die Sprache bietet weitere spannende Geschichten, Sagen und Mythen. Bis heute ist der Name dieses Waldgebietes ungeklärt.
Bild: mystisch schlängelt sich die Lachte durch die Sprache.
Quelle: H. Altmann.
Ein alter Versammlungsplatz?
Der Rektor der lateinischen Schule in Celle, Johann Heinrich Steffens, erwähnte die Sprache bereits 1763 in seiner "historischen und diplomatischen Abhandlungen in Briefen". Laut Steffens war die Sprache einst wesentlich ausgedehnter als die es heute ist. So sollen sich ausgedehnte Eichenwälder bis hinter das heutige Altenhagen erstreckt haben. Dies scheint durchaus plausibel zu sein, denn auch in alten Karten finden sich Hinweise darauf, dass die Sprache einst um einiges größer gewesen ist.

Bild: Celle und die Sprache um 1640.
Quelle: Marchiae Brandenburgensis 1640.
Auch alte Flurnamen im Raum Altenhagen deuten auf einstige Waldungen in diesem Bereich hin - das sogenannte "Roland" zwischen Altenhagen und Garssen sei nur ein Beispiel. Steffens gab in seinem 1763 erschienenen Werk an, dass einige alte Gebäude in Celle aus den starken Eichenstämmen von dort errichtet worden seien.
Im Zusammenhang zu Altenhagen deutete Steffens den Namen Sprache als einst "Sprake" bzw. "Hagesprake". Dahingehend wertete Steffens die Sprache als alten Versammlungs- und Gerichtsplatz. Der deutsche Hauslehrer, Archäologe und Schriftsteller, Johann Georg Keyßler hatte in seiner Abhandlung über das Leben der alten sächsischen und keltischen Stämme bereits um 1720 berichtet, dass Wälder und Flüsse als traditionelle Versammlungsplätze genutzt wurden.
Steffens sah die Sprache somit als einen traditionellen Versammlungsplatz der sächsischen Vorfahren an. Allerdings soll es sich nicht um einen Landtagsplatz, sondern vielmehr um einen Versammlungsort für untergeordnete, die einzelnen Gaue betreffende Angelegenheiten gehandelt haben.
Was hatte es mit den Gauen auf sich?
In der Tat scheint die Sprache einst eine Rolle bei der Grenzziehung gespielt zu haben. Noch nachdem Karl der Große um 803 die Sachsenstämme mit dem Schwert zum Christentum zwang, existierten die alten Gaugrenzen fort. Diese dienten einst, um die Stammesgebiete zu unterteilen und waren sozusagen Verwaltungsbezirke in denen der jeweilige Stammesfürst seine Macht ausübte. Es kann nicht genau beziffert werden wie alt diese alten Gaue waren - vermutlich reicht ihre Existenz allerdings weit in die Geschichte zurück.
Celle gehörte einst zum Gau Flotwedel (= Flutwidde), welches sich heute noch als Namen für die politische Samtgemeinde Flotwedel erhalten hat. Früher war dieser Gau allerdings um einiges größer. Celle befand sich in einem Untergau des Flotwedel - dem sogenannten "Mulbeki" oder auch "Mulbeze". Die Aller trennte den Gau Flotwdel bei Celle vom sogenannten Lohengau, bzw. dem Muthwidi (="Schutzwald"). Weiter östlich schloss sich der Gretingau ("Gred" = Weide) an.
Eine nachfolgende Karte zeigt die einstige geografische Lage der drei Gaue.
Bild: Gaugrenzen um Celle.
Quelle: aus Clemens Cassel, Geschichte der Stadt Celle.
Der einzige Treffpunkt der drei alten sächsischen Gaue war ein Ort im Norden der Sprache - hier trafen Lohengau, Flotwedel und Gretingau zusammen. In diesem Bereich befindet sich die sogenannte "Hohe Warte". Die alten Gaugrenzen stimmten regelmäßig mit den späteren Grenzen der kirchlichen Diözesen überein. So finden sich die Grenzen der alten Gaue in den Grenzbeschreibungen der späteren Diözesen wieder.
Die "Hohe Warte" wäre ein möglicher Punkt, der für das Zusammentreffen der alten Gaugrenzen geeignet scheint. Hier befinden sich einige höher gelegene Dünenhügel, die bereits vor hunderten Jahren existiert haben müssen. Clemens Cassel gibt in seiner geschichtlichen Betrachtung Celles das Jahr 1447 als erste Erwähnung an - leider ohne eine Quelle zu benennen. Ob die Hohe Warte der einstige Treffpunkt der Gaugrenzen war, bleibt dahingestellt. Vieles spricht dafür, dass hier eine traditionelle Grenze verlief, denn Grenzen wurden früher über lange Zeit beibehalten.
 Bild: Hohe Warte in der Sprache.
Quelle: H. Altmann.
Bild: Hohe Warte in der Sprache.
Quelle: H. Altmann.
Die Hohe Warte scheint als nördlichste Grenze Celles bestens geeignet gewesen zu sein, um vorbeiziehendes Kriegsvolk zu beobachten. Noch heute finden sich in dieser Gegend zahlreiche alte Grenzsteine, welche die Forstgrenzen markieren. Natürlich sind diese Steine neuzeitlicher Herkunft - jedoch wurden Grenzen nicht selten seit jeher beibehalten.
 Bild: Grenzstein an der Hohen Warte.
Quelle: H. Altmann.
Bild: Grenzstein an der Hohen Warte.
Quelle: H. Altmann.
An der Sache mit den Gaugrenzen scheint zumindest einiges dran zu sein. Die Hohe Warte als markante Flurbezeichnung eines Dünenzuges im nördlichen Bereich der Sprache kommt scheint auf einen möglichen Versammlungsort, bzw. einen Ausguck hinzudeuten. Leider gibt es keine schriftlichen Belege, die diese Theorie stützen.
Was alte Karten verraten...
Blickt man in historische Karten, so findet man zahlreiche Belege für den Waldnamen "die Sprache". Bereits um 1650 gab es kartografische Belege für den Namen. Allerdings sind Karten aus dieser Zeit recht ungenau. Straßen und Wege sind nur grob erkennbar und haben kaum etwas mit der heutigen Topografie gemeinsam. Vielmehr zählt daher der Erkennbare Name "Sprache, welcher in der Karte östlich von Lachtehausen verzeichnet ist.
Hier wurde die heutige "Sprache" noch als "Sprake" bezeichnet.

Bild: Die Sprache 1650.
Quelle: Archiv Altmann.
Der Name dauerte fort - auch im Jahr 1706 wurde das Waldgebiet als "die Sprake" bezeichnet.
Bild: Die Sprache 1706.
Quelle: Ducatus Luneburgensis.
Es stellt sich die Frage wann die heutige Straße durch die Sprache entstand. Im Jahr 1727 entstand die Karte der "Environs der Statt Zell" - also eine Umgebungskarte der Stadt Celle. Sie zeigt den Waldnamen der Sprache und einen Weg der sich in östliche Richtung von Lachtehausen durch den Wald schlängelt. Aber auch dieser Weg ist aufgrund der Ungenauigkeiten des Kartenwegs noch nicht mit der heutigen Straße gleichzusetzen.
Bild: Die Sprache 1727.
Quelle: Environs von der Statt Zell.
Erst 1780 zeigt eine Karte einen nachvollziehbaren Wegverlauf durch die Sprache. So führte die Straße einst nördlich der heutigen L 282 entlang der Lachte durch den Wald. Die Kurhannoversche Landesaufnahme zeigt sowohl den Verlauf dieses Weges, als auch eine angelegte Allee in welche die Straße bei Lachtehausen mündete.
Bild: Die Sprache 1780.
Quelle: Kurhannoversche Landesaufnahme.
Noch bis ins 19. Jahrhundert musste man einige Wegschlenker beim Passieren der Sprache in Kauf nehmen. So zeigt die topografische Spezialkarte aus dem Jahr 1822 "die Spracke" noch mit dem alten Wegverlauf entlang der Lachte.
Bild: Die Sprache 1822.
Quelle: Topografische Spezialkarte.
Noch 1839 war dieser Wegverlauf üblich und wurde genutzt. Die heutige schnurgerade Straße gab es noch nicht. Allerdings findet sich in den entsprechenden Kartenwerken bereits der heute übliche Name des Waldgebietes "Sprache".
Bild: Die Sprache 1839.
Quelle: Papen Atlas.
Erst im preußischen Messtischblatt von 1899 ist die heutige L 282 in ihrem geraden Verlauf verzeichnet. Die alte Straße in der Sprache ist allerdings heute noch erkennbar - zum Beispiel auf einem aktuellen Satellitenbild. Hier ist ebenfalls die Hohe Warte verzeichnet. Sie liegt hart nördlich der alten Straße.
Bild: Die Sprache- alte Wegverläufe und Hohe Warte.
Quelle: Google Earth.
Zusammenfassung...
Die Sprache hat ihren Namen über die Jahrhunderte beibehalten. Es ist schwer zu sagen woher dieser rührt. Möglicherweise gab es in diesem Waldgebiet einst tatsächlich einen Versammlungsort der angrenzenden Gaue. Stimmen die alten Grenzbeschreibungen trafen am nördlichen Rand der Sprache der Lohengau, der Gretinggau und der Flotwedel aneinander. Hier befindet sich ebenfalls die "Hohe Warte" - eine Dünenerhebung, die einst den alten Grenzverlauf markiert haben soll.
Einst war die Sprache vermutlich ein schwer passierbares Gebiet. Einige Heimatforscher gehen deshalb davon aus, dass größere Heereszüge die Sprache einst nicht passieren konnten und in südliche- bzw. nördliche Richtung ausweichen mussten. Ohne Frage - vor der Anlegung zahlreicher Abwassergräben war der Wald sicher noch morastiger als heute. Der Heimatforscher Hans-Günther Michels aus Suderwittingen vermutet sogar, dass einst Karl der Große bei seinen Eroberungszügen bei Altencelle über die Aller ging. Allerdings geht Michels davon aus, dass Karl der Große nicht durch die Sprache gehen konnte, sondern südlich in Richtung Ahnsbeck auswich.
Bild: Morastiges Gelände.
Quelle: H. Altmann.
Inwiefern diese Vermutungen stimmen ist ungewiss. Es gibt weder Belege für einen Durchmarsch Karls des Großen, noch für die Existenz eines alten Versammlungsplatzes im Waldgebiet der Sprache. Allerdings scheinen einige der Annahmen nicht mal so abwegig zu sein, denn eines kann man dem Namen "Sprache" nun wirklich nicht absprechen: dass er durchaus langlebig ist.
Eben dies deutet tatsächlich auf einen Zusammenhang zu alten Grenzen hin. Die einstigen Gaugrenzen waren über lange Zeit die wichtigsten Gebietseinteilungen. An ihnen wurden nicht selten spätere Ämter-, Kirchen- Landkreis- und Gerichtsgrenzen festgemacht. Somit besaßen die Grenzen der früheren Gaue oft einen Bezug zu späteren Verwaltungsgrenzen. Es wäre nicht verwunderlich, wenn sich in der Sprache eine solche Grenze befunden hat.
Da sich der Name zumindest über die letzten Jahrhunderte erhalten hat, kann man zweifellos davon ausgehen, dass der Wald einen markanten historischen Bezug besitzt. Dafür stehen ebenfalls die Sagen und Legenden, welche von Begebenheiten im Zusammenhang mit der Sprache erzählen.
H. Altmann
_______________________________________________________
Quellen:
- Johann Heinrich Steffens, Celle im Lüneburgischen, 1763
- Schulchronik Nienhagen
- Clemens Cassel, Geschichte der Stadt Celle, 1930.
- Bettinghaus, Zur Heimatkunde des Lüneburger Landes, 1897.